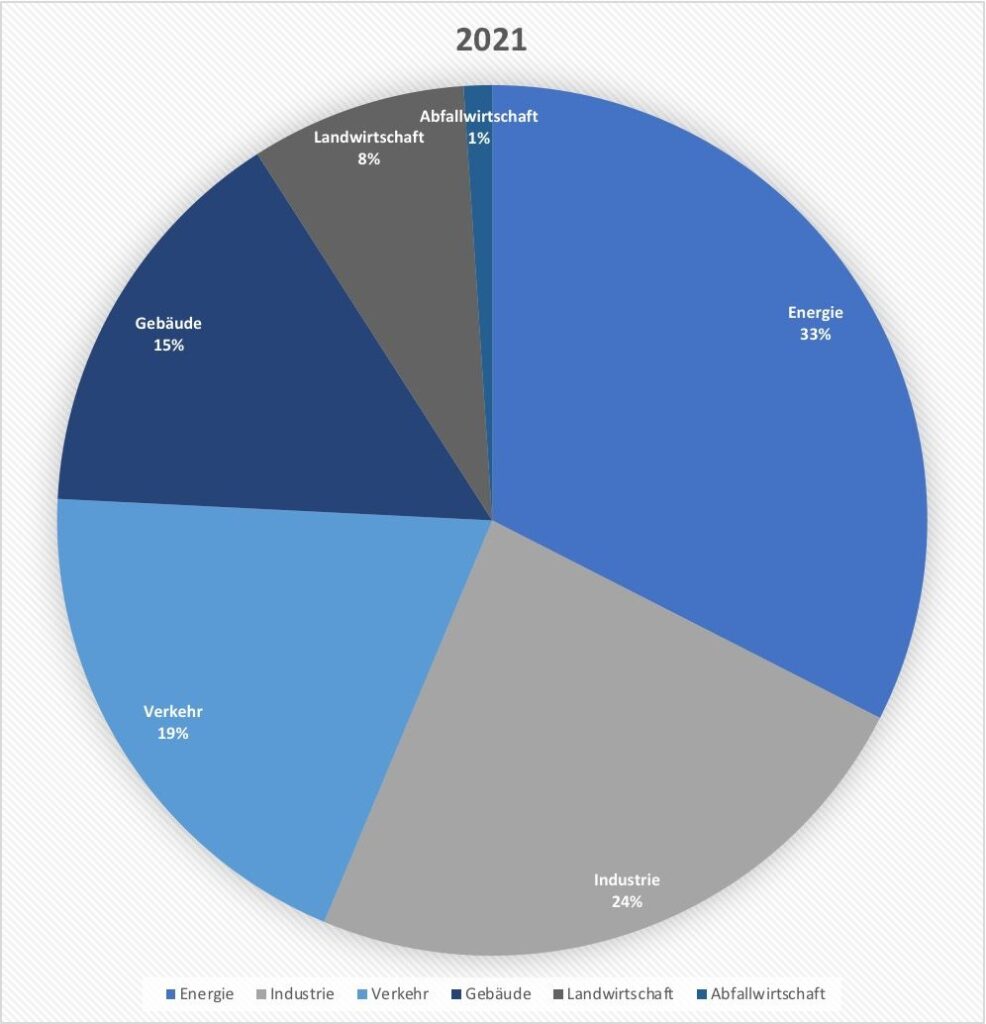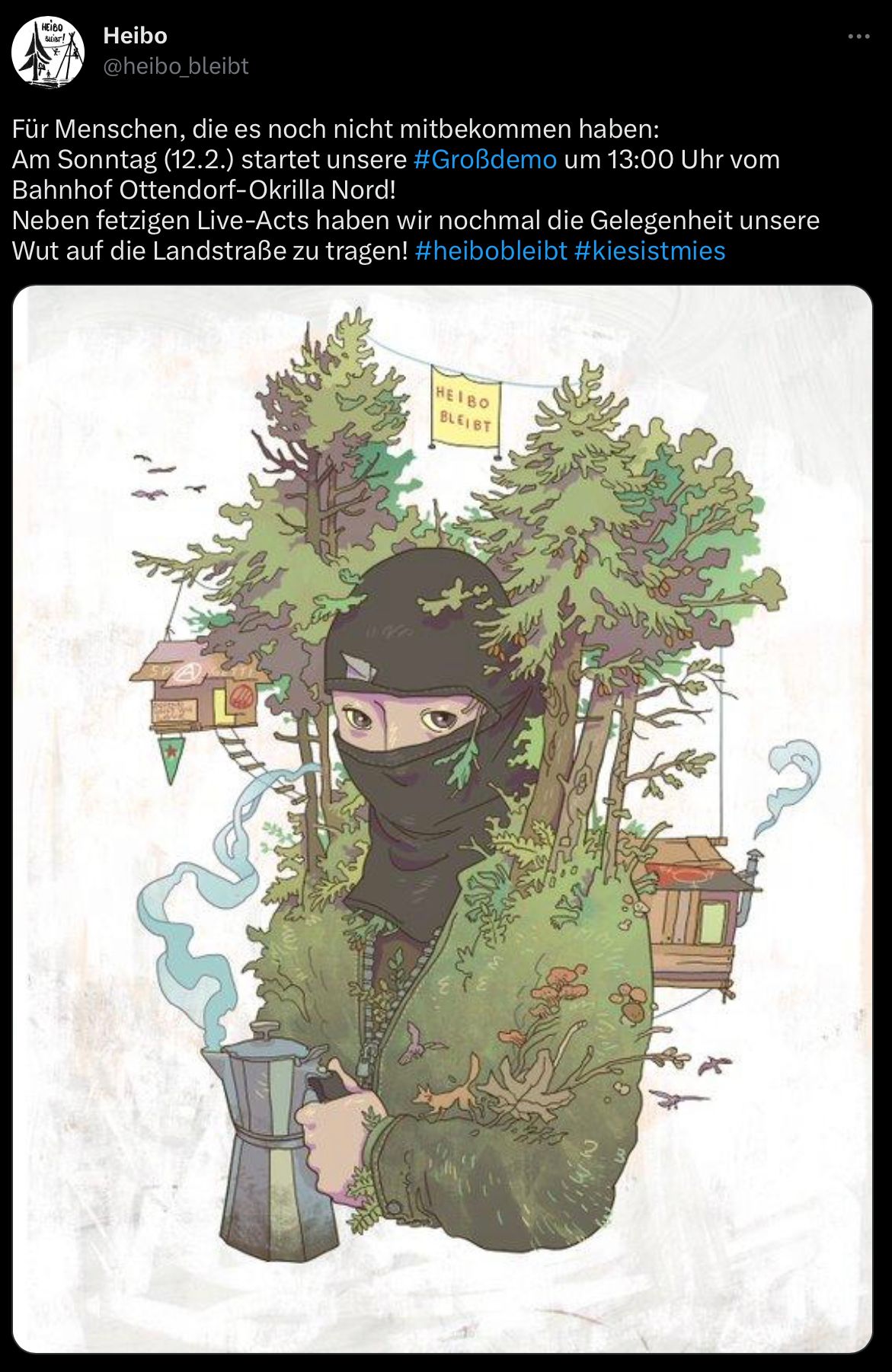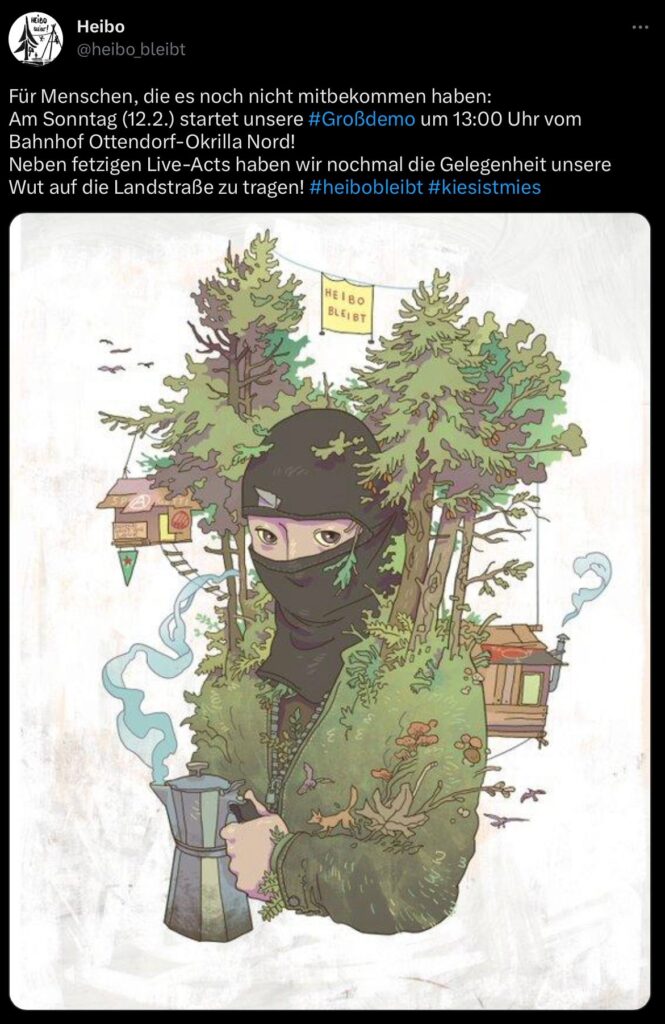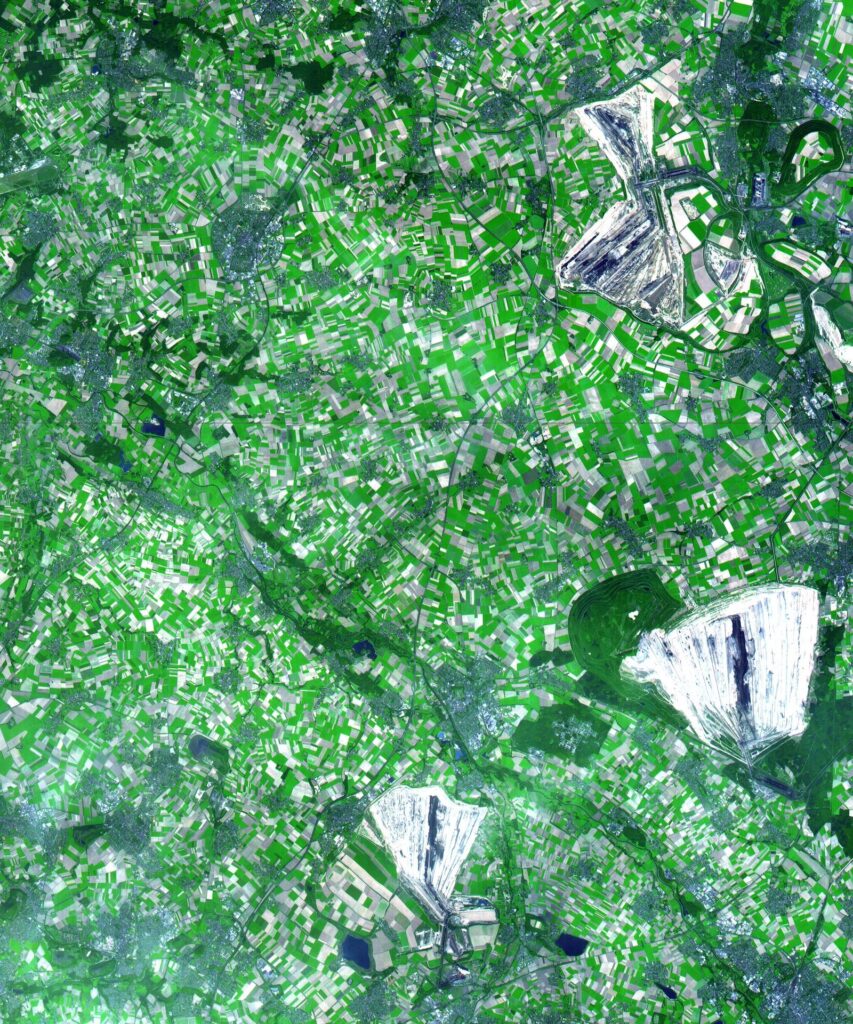Elischa Kaminer zieht sich zuerst die Schuhe aus und zündet zwei Kerzen an. In aller Ruhe. Eine Ruhe, die gebrochen werden wird, aber den Raum zugleich auch nicht mehr verlassen wird in den fast drei Stunden, die „strings of love and hate“ in Anspruch nehmen wird. Es sind langsame, bedachte Bewegungen, bis Kaminer sich in der Mitte der Bühne wiederfindet, im Lichtkegel, und mit einem jüdischen Zemirot, klagend, den ersten Gesangspunkt des Abends setzt. Und damit auch die Stimmung, in der sukzessive die weiteren Künstler:innen hinzustoßen. Zuerst kommen Angela Wai Nok Hui und MikoLaj Rytowski hinzu, dann betritt die Violinistin Mayah Kadish die Bühne. Langsam, bedacht, schleichend. Auch sie ziehen die Schuhe aus. Die Bühne wird in diesem Beginn zu einem heiligen Ort.
strings of love and hate ist, so führt Kaminer an diesem Beginn das Publikum ein, sei das Resultat individueller und kollektiver Krisen. Ein Teil von deren Verarbeitung. Es nimmt uns mit auf eine Reise, und Kaminer ist wichtig, zu betonen, dass wir in dieser Reise nicht gefangen sind. Wir sollen gehen und wiederkommen, wenn wir das wollen oder brauchen. Kaum jemand wird es tun.
Krisen sind Situationen des Durcheinanders von Gedanken und Gefühlen. Und so bleibt die Ruhe des Beginns kein dauerhafter Zustand. Schon wenig später schreit Maya Kadish in einem verzweifelten, zerfahrenen Monolog ins (aber nicht gegen das) Publikum. „I think i’ve been here before“, beginnt sie mehrfach, immer wieder. Debattiert, was sie erlebt: Eine Erinnerung? Ein Flashback? Sie wird schneller, durchwühlter, lauter, und uns wird klar: Das ist kein Flashback, das ist eine Erinnerung, der Wunsch des Wiedersehens, der Gedanke an eine verschwundene Person. „I loved you with all my heart“, schreit sie. Immer wieder. „Please continue“.
Zu viel, das alles? Das ist eine aktiv formulierte Frage zur Pause. Sanfte Klaviermusik, klare Brüche und beklemmende Einlagen wie dieser Monolog führen in einen sehr besonderen Raum, in starke Emotionen. Es geht sehr tief, was die vier Künstler:innen hier schaffen. Die Musik dieses ersten Teils, die klaren harmonischen Brüche, tun ihr übriges für das beklemmende Gefühl, die tiefe Trauer dieser ersten Hälfte; der Verlustgeschichte.
Aber es gibt relief. Schon mit der Pause, in die entlassen man Zeuge von Gemeinschaft und Schönheit wird. Kaminer spielt leise und melodisch, zurückgefunden zur Ruhe des Anfangs am Klavier weiter, Nok Hui und Rytowski schnappen sich gleich zwei Badmintonschläger und spielen drauf los. Die Pause selbst ist ein Statement, ein Bruch. Aber erstmal müssen wir raus, trotzdem. Durchatmen.
Die Energie der Pause bleibt uns dann im zweiten Teil erhalten. Es bleibt zwar ein Auf und Ab, in dem Kaminer und sein Ensemble in mehrfacher Hinsicht richtig aufdrehen: Kaminer entledigt sich seiner Jacke um sein langes, rotes Abendkleid, das bisher unter einer Jacke nur angedeutet war, zu präsentieren; und auch die anderen Musiker:innen ziehen sich um. Es gibt Eskapismus, eine Party zu Berliner Techno, mit allem was dazugehört, auch des Puppy Kinks. Es gibt disharmonische Epik, überwältigende Lautstärke, zerbrochene Teller, Klänge einer brechenden, zerfasernden E-Violine. Rock bottom, Überwältigung der Musik.
Der zweite Teil ist daneben aber primär – und nachhaltiger – dominiert von Darbietungen des Haltes. Vom Zusammensein, vom gemeinsamen am Tisch-sitzen, von „family or chosen family“, tiefer Freundschaft. Die Künstler:innen sitzen am Tisch, schälen und essen Granatapfel. Kurz darauf bestellt Kadish italienische Pizza, die wenig später auf die Bühne geliefert wird. Auch für das Publikum. Und so essen die vier Künstler:innen und wir in aller Ruhe, wie abstandnehmend vom Leid, vom Stück. Es wird geredet, gelacht. Wir heilen in diesem Moment ein bisschen.
Und so endet der Abend mit einem Stück, das das Leid mit Hoffnung verbindet. „Where die you go where did you go“ stellt eben diese titelgebende Frage und beantwortet sie auch „I’m in the trees I’m in the trees“. Wie den Abend über braucht es das Ensemble wenig Text um viel zu transportieren und so lebt auch dieser abschließende Song von der ständigen Wiederholung, dem sanften Einarbeiten des Textes in die Seele. Und als Publikum sind wir beteiligt am Heilsamen dieses Prozesses. Aufgefordert, zu singen, tragen wir eine Strophe bei, die auf den Lippen bleibt:
And I will sing like I know
That we will meet again
Hoffnung in der Trauer. Das ist die Abschlussnote. Und nichts davon war am Ende zu viel, auch wenn der Verlust des ersten Teils definitiv hart war.
Kaminer setzt gegen Ende einen kleinen politischen Akzent, spricht von der Schwierigkeit des Lebens in einer Welt von Genozid, Ecozid, Rechtsruck, Antisemitismus und Queerfeindlichkeit. Es ist die einzige offene politische Bezugnahme des Abends, die dann eher einem Rundumschlag gleicht als alles andere. Sie wirkt ein bisschen verloren, aber auch nicht fehl am Platz. Man kommt so nicht in Versuchung, das den Abend prägende Leid und dessen Verarbeitung aus der Offenheit und ihrer multiplen Anschlussfähigkeit herauszunehmen, es genauer zu beziehen. Die Krise, aus der das Stück geboren ist, bleibt doch vage. Sie wird vom Stück nicht repräsentiert, sie wird eingefangen in ihren Implikationen.
In den drei Stunden Konzert und Performance ist es nicht die Masse an Liedern oder Darbietungen, die begeistert. Im Gegenteil zählt Kaminers Liste von Liedtexten nur drei Lieder, textlos mögen es mehr sein, aber nicht viel mehr. Nein, was hier wirkt und nachhalt ist ein wundervolles, im ständigen Bruch der Harmonien und Abläufe genauso wie in der regelmäßigen Wiederaufnahme von Melodien funktionierendes Erlebnis. Eine emotionale Reise, die ihresgleichen suchen dürfte.